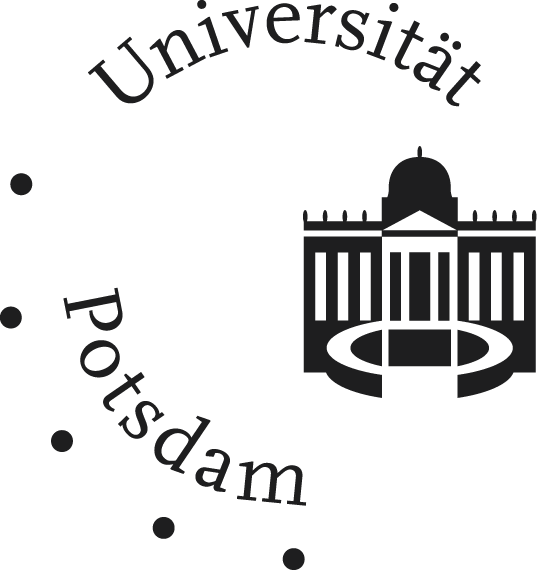Projektdokumentation
Persönliche Einordnung und Motivation
Bevor ich in die eigentliche Dokumentation des Projekts starte, möchte ich es kurz persönlich einordnen. Bis ins Erwachsenenalter hinein habe ich den größten Teil meiner Kindheit und Jugend in Fennpfuhl verbracht – zunächst in der Möllendorffstraße, ab der Jahrtausendwende dann in der Rudolf-Seiffert-Straße. Als Mitglied der WGli konnte meine Familie mit Beginn der Renovierungsarbeiten in der Möllendorfstraße schnell in ein bereits vollständig modernisiertes Wohngebiet umziehen. In Anbetracht der heutigen Wohnsituation kaum vorstellbar: Auch hier war es die Mitgliedschaft in der Wohnungsgenossenschaft, die mir Jahre später beim Auszug von meinen Eltern innerhalb weniger Wochen meine erste eigene Wohnung in der Paul-Zobel-Straße ermöglichte.
Meine Schulzeit habe ich vollständig in Schulgebäuden des Typs Berlin SK abgegolten. Nach der 4. Grundschule Lichtenberg ging es in die damalige Jesse-Owens-Realschule im Wohngebiet II am Volkspark Friedrichshain. Auch diese wurde wegen ihres maroden baulichen Zustandes geschlossen und später abgerissen. Die zehnte Klasse verbrachte ich in der Philipp-Reis-Oberschule, immerhin in Alt-Hohenschönhausen und nicht mehr in Lichtenberg.
Seit einigen Jahren wohne ich nun nicht mehr im Fennpfuhl. Obwohl ich mich zunächst über den „Tapetenwechsel“ gefreut hatte, wurde mir immer wieder bewusst, wie sehr mich das Aufwachsen im Fennpfuhl unbewusst geprägt hat. Während ich einerseits das Gefühl hatte, mich an den manchmal etwas erdrückend hohen Plattenbauten sattgesehen zu haben, fehlten mir viele der Aspekte, die in der Literatur über die städtebauliche Konzeption nur allzu häufig betont werden: Kurze Laufwege, die Ausrichtung auf den Weg zu Fuß gegenüber dem Auto, die Abschirmung vom Straßenlärm abseits der Hauptverkehrswege, um nur einige zu nennen.
In den letzten Jahren hat sich aus dieser Empfindung eine Faszination für die komplexeren Neubaugebiete der DDR entwickelt. Das Studium der EMW spielte in verschiedener Hinsicht in dieses Interesse an der DDR hinein, die ich als Jahrgang 1990 selbst nicht mehr erlebt hatte. Zum einen hatte die Auseinandersetzung mit Filmen wie Karla (Zschoche, 1965) und Bis daß der Tod euch scheidet (Carow, 1979) einen erheblichen Einfluss auf die Ideenfindung für das Projekt. Zum anderen blieb mir ein Kurs aus dem Bachelor im Gedächtnis, in dem wir uns anhand verschiedener Beispiele mit der Darstellung von Städten und Architektur auseinandergesetzt haben.
Theoretische Einordnung und Projektidee
Am Anfang der Projektkonzeption stand die beinahe beiläufige Feststellung, dass sich in meinem ehemaligen Wohnort nahezu keine Spuren meiner früheren Grundschule finden lassen. Seit ihrem Abriss im Jahr 2005 verweist lediglich die alleinstehende Sporthalle auf das zum typischen Ensemble gehörende, nun aber fehlende Schulgebäude. Die heutige Grünfläche mit einem schlichten Rundweg und einigen Parkbänken für sich genommen lässt nicht mehr erkennen, dass sich hier jemals ein Schulgebäude befunden hat. Auch eine einfache Google-Suche nach dem Namen „4. Grundschule Berlin-Lichtenberg“ liefert kaum Ergebnisse. In einigen öffentlich zugänglichen Dokumenten zum Stadtumbau Ost wird sie meist nur als „eine nicht mehr benötigte Schule“ oder mit dem Hinweis auf die Adresse als „Schule Rudolf-Seiffert-Straße 37“ erwähnt (Balzer, 2007).
Über das persönliche Interesse hinaus bot diese Beobachtung Anlass für weiterführende Fragen nach den gesellschaftlichen Entscheidungsprozessen: Was gilt als erinnerungswürdig? Auf welche Weise entscheidet eine Gesellschaft, woran sie sich erinnert und woran nicht? Wie gerät etwas ins kollektive Vergessen?
Das Projekt zielt darauf ab, diese Fragen durch die praktische Arbeit aufzugreifen, ohne sie abschließend beantworten zu wollen. Um sich dem Thema kollektives Gedächtnis anzunähern, gilt es zunächst zu klären, was in dieser Arbeit darunter verstanden werden soll. Eine umfassende Wiedergabe der Geschichte des Forschungsfeldes und Diskussion verschiedener Betrachtungsweisen kann und soll an dieser Stelle nicht erfolgen, da sie den Rahmen der Projektarbeit übersteigen würde. Einige essenzielle Grundbedingungen werden durch eine grundlegende Begriffsklärung der Professorin für Anglophone Literaturen und Kulturen Astrid Erl in ihrem Einführungsbuch Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen deutlich:
Das ›Kollektive Gedächtnis‹ ist ein Oberbegriff für all jene Vorgänge organischer, medialer und institutioneller Art, deren Bedeutung bei der wechselseitigen Beeinflussung von Vergangenem und Gegenwärtigem in soziokulturellen Kontexten zukommt (Erl, 2005, S. 6).
Die Projektarbeit beschäftigt sich mit einem zurückgebauten Gebäude, dessen fehlende Spuren im Internet und demzufolge auch mit Architektur und unserem Umgang mit ihr. Insbesondere die medialen Vorgänge und deren Funktionen sollen daher in der folgenden Betrachtung im Vordergrund stehen.
Erl (2005, S. 137–139) greift dabei eine notwendige Unterscheidung zwischen drei wesentlichen Funktionen von Medien des kollektiven Gedächtnisses auf. Diese können einzeln oder anteilig in Kombination auftreten. Sie beschreibt Medien, die Inhalte des kollektiven Gedächtnisses speichern, Medien, die zur Verbreitung und Zirkulation solcher Inhalte dienen und mediale cues, die zum Abrufen von Erinnerungen anregen. Medien mit einer Speicherfunktion haben die Aufgabe, Inhalte dauerhaft verfügbar zu halten. Speichermedien können konkrete Monumente, Denkmäler oder textuelle Werke sein. Als ein solches markantes Beispiel wird die Bibel genannt. Erl weist darauf hin, dass solche Speichermedien mit der Zeit nicht nur an etwas erinnern, sondern dazu neigen, selbst zu Gegenständen zu werden, an die erinnert wird. Davon zu unterscheiden sind Zirkulationsmedien, die gespeicherte Informationen auch über räumliche Distanzen hinweg verbreiten: Also meist Massenmedien wie Bücher, Fernsehübertragungen und das Internet. Dabei betont Erl jedoch, dass Medien des kollektiven Gedächtnisses nicht auf die implizierten Elemente eines klassischen Kommunikationsmodells wie Sender, Kanal und Empfänger angewiesen sind. Vielmehr werden Erinnerungsprozesse häufig durch mediale cues in Gang gesetzt. Bilder, Orte, Landschaften oder Texte können Assoziationen mit bestimmten Vergangenheitsversionen hervorrufen. Welche Erinnerungen ausgelöst werden, kann dabei jedoch, je nach individuellem Wissensstand und eigener ideologischer Ausrichtung, durchaus variieren. So wie von Erl beschrieben, wären sie dann nicht automatisch mit konkreten Inhalten verbunden, sondern müssen erst durch Erzählungen mit Erinnerungen aufgeladen werden.
Dabei sollte kurz angemerkt werden, dass Erinnerungen nie authentische Rekapitulationen vergangener Ereignisse darstellen, sondern immer konstruiert sind:
Erinnerungen sind keine objektiven Abbilder vergangener Wahrnehmungen, geschweige denn einer vergangenen Realität. Es sind subjektive, hochgradig selektive und von der Abrufsituation abhängige Rekonstruktionen. Erinnern ist eine sich in der Gegenwart vollziehende Operation des Zusammenstellens (re-member) verfügbarer Daten (Erl, 2005, S. 7).
Erls Überlegungen folgend, lässt sich Architektur als Medium des kollektiven Gedächtnisses begreifen, das sowohl Speicherfunktion übernehmen als auch als medialer cue wirken kann. Fragen nach dem Erhalt, Abriss oder gar Wiederaufbau von nicht mehr vorhandenen Gebäuden bringen oft Herausforderungen mit sich. Hinsichtlich der gesellschaftlichen Frage danach, welche Bauwerke als erinnerungswürdig gelten sollten, beschreibt der Philosoph und Kunstkritiker Boris Groys in Logik der Sammlung – Am Ende des musealen Zeitalters (1997, S. 96–97) ein interessantes Spannungsfeld. Zunächst beschreibt er eine Unterscheidung zwischen dem Monumentalen und dem Vergänglichen. Monumentale Bauten seien dabei jene, die aus einer Historie stammen, die so weit zurückreicht, dass sie uns nicht mehr zugänglich ist. Die Weltanschauung, unter der sie errichtet wurden, sei dann für Fragen nach Erhalt und Abriss nicht mehr relevant. Die Welt wäre demnach ohne diese Bauten gar nicht mehr vorstellbar. Demgegenüber stehen Gebäude, die zu unseren Lebzeiten oder dieser Zeitspanne zumindest sehr nahe errichtet wurden. Die Vorstellung eines möglichen Verfalls und Abrisses wäre bei diesen zumindest im Bereich des Möglichen.
Für das Beispiel des Schulgebäudes im DDR-Typenbau könnte hier bereits eine Teilantwort auf die eingangs gestellten Fragen liegen. Neben den vielen Bauten der Reihe Berlin SK steht im näheren Umfeld das 1910 errichtete Gebäude der Schule Am Rathaus. Es ist zwar noch nicht zwangsläufig als monumental anzusehen, doch lässt sich argumentieren, dass sein Alter einen Abriss weniger wahrscheinlich werden lässt. Durch den Bau noch vor dem Ersten Weltkrieg wird ein solches Gebäude weniger mit Weltanschauungen in Verbindung gebracht, als es bei einer von vielen industriell hergestellten DDR-Schulen der Fall ist. Das junge Alter der Schule an der Rudolf-Seiffert-Straße 37 hätte das Gebäude dann paradoxerweise vergänglich gemacht.
Demgegenüber stellt Groys jedoch mithilfe des touristischen Blicks die Vorstellung einer gegenläufigen Entwicklung. Dieser würde jegliche Stadtansicht im jeweiligen Ist-Zustand monumentalisieren. Der Wahrnehmung einer Person, die einen Ort besucht, sind historische Veränderungen nicht zugänglich, sodass der Zustand, den der Ort zu diesem Zeitpunkt hat, entscheidender wird. „Dann ist es für uns im Grunde kein Unterschied, ob einzelne Monumente zweitausend, zwanzig Jahre alt sind oder, wenn man so will, gestern erst gebaut wurden“ (Groys, 1997, S. 99). In der Folge verliert die Unterscheidung zwischen historisch bedeutsamen und beiläufigen Bauwerken an Gewicht – ohne Differenzierung erscheinen alle gleichermaßen monumental (Groys, 1997, S. 98–100).
Groys adressiert die Spannung zwischen Bewahrung und Wandel im Stadtbild, um in seinem Buch eine Argumentation zur Transformation des Museums im digitalen Zeitalter aufzubauen. An dieser Stelle überschneiden sich seine Überlegungen mit Erls Gedanken zur Wissenserhaltung im Internet, die bereits 2005 auf die paradoxe Spannung zwischen wachsenden Möglichkeiten der Speicherung bei gleichzeitiger Gefahr des Vergessens hinweist:
Die digitale Revolution führt uns den paradoxen Zusammenhang von medialen Speichermöglichkeiten und der Gefahr des Vergessens vor Augen. Denn solange Informationen auf Festplatten ruhen, sind sie ›totes Wissen‹. Auswahl und Aneignung des Erinnerungswürdigen wird angesichts der digitalen Daten-Fülle jedoch immer schwieriger. (Erl, 2005, S. 3)
In ihrem Buch Soziales Vergessen – Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft betont die Soziologin Elena Esposito die notwendige Fähigkeit des Gedächtnisses, Inhalte zu vergessen. Erst das Vergessen ermöglicht es, neue Informationen im Verhältnis zu Vergangenem einzuordnen, zu bewerten und sich dadurch in der Gegenwart zu orientieren. Das Gedächtnis selbst beschreibt sie als den Mechanismus, der zwischen Vergessen und Erinnern unterscheidet. Dem Vergessen schreibt sie dabei eine besondere Wirkung zu, da es nur möglich sei, sich daran zu erinnern, dass man etwas vergessen hat, nicht aber an das Vergessene selbst (Esposito, 2002, S. 28–29).
Besonders im Internet zeigt sich ein von Esposito beschriebener Mechanismus der Ausweitung der Fähigkeiten des Gedächtnisses:
Die beste Art, Erinnerungen auszulöschen, besteht nicht im Löschen von Informationen […], sondern in der Produktion eines Überschusses an Information – nicht durch die Erzeugung einer Abwesenheit, sondern der Vervielfältigung von Präsenzen (Esposito, 2002, S. 29–30).
Vor diesem Hintergrund kann nun das konkrete Fallbeispiel meiner Projektarbeit betrachtet werden. Das Gebäude meiner ehemaligen Grundschule existiert nicht mehr. Mediale cues, die auch Menschen, die nicht ohnehin wissen, dass sie dort stand, zur Erinnerung anregen könnten, sind nicht vorhanden. Die meisten Informationen über die Schule liegen in Archiven der Bezirksämter oder, in Form von Fotos, Zeugnissen und ähnlichem, in privaten Haushalten. Diese Daten können als totes Wissen betrachtet werden. Die wenigen Informationen im Internet sind fragmentiert und verstreut und nicht in einer zusammenhängenden Erzählung miteinander verknüpft.
Die Grundidee meines Projekts war es nun, das fragmentierte Wissen aus verschiedenen Quellen zusammenzuführen und daraus Erinnerungen an das ehemalige Schulgebäude zu konstruieren und diese als mediales Angebot sichtbar zu machen. Durch die Verknüpfung des Schulgebäudes mit der Historie des Ortes sollte den Rezipierenden auch ein Gefühl für seine Relevanz vermittelt werden. Die fragmentierten Daten sollten chronologisch aufbereitet werden, um die Entwicklung des Schulgeländes und des Ortes Fennpfuhl nachvollziehbar zu machen, und dabei zugleich die nur kurze Existenz des Gebäudes und die Relevanz von Bau und Rückbau für die städtebauliche Entwicklung dieser Zeit sichtbar zu machen.
Da bisher insbesondere im Internet nur wenige Informationen zur Schule verfügbar waren, stand früh der Grundgedanke fest, die Dokumentation in Form einer Website aufzubereiten, die die Erzählung der Schule mit der des Ortes zusammenführt. Im Gegensatz zu den archivierten „toten“ Daten sind die vorhandenen ausführlichen Publikationen über den Ort Fennpfuhl zwar lebendig, jedoch an bestimmte Bedingungen von Verfügbarkeit und Zugänglichkeit gebunden. Eine digitale Plattform bietet hier den Vorteil, die Inhalte möglichst niederschwellig und breit zugänglich zu machen und flexibel zu vernetzen.
Neben der chronologischen Rekonstruktion entstand früh die Idee, der Website durch weitere Elemente einen essayistischen Charakter zu verleihen. Einerseits sollte so ein persönlicher Bezug hergestellt und der subjektive Zugang zum Erinnern verdeutlicht werden, andererseits sollte die aus der Distanz betrachtete Historie durch persönliche Anekdoten ergänzt werden, um die konstruktive Dimension von Erinnerung aufzugreifen. Zudem sollten ausgewählte Zitate aus der verwendeten Literatur die Darstellung des Schulgebäudes mit grundlegenden Überlegungen zum kollektiven Gedächtnis verknüpfen und so einen thematischen Rahmen für das Projekt bilden. Hinweise auf weiterführende Literatur, Podcasts und Websites sollten die Erzählung schließlich über das konkrete Fallbeispiel hinaus öffnen und in ein größeres Netzwerk von Wissen und Erinnerungskultur einbetten.
Projektablauf
Mit einem Besuch der Dauerausstellung im vom Bezirksamt Lichtenberg organisierten Museum Lichtenberg im Stadthaus startete am 9. Mai die eigentliche Recherche für das Projekt. Aufgrund des sehr breiten Überblicks über den gesamten Bezirk geht die Ausstellung nur in einigen Punkten auf das Neubaugebiet Fennpfuhl ein. Der Besuch bot jedoch eine Vielzahl an Anknüpfungspunkten und Hinweise auf neue Anlaufstellen für die weitere Recherche. In erster Linie entstand auf der Suche nach Material der Kontakt zum Archiv- und Sammlungsleiter vom Museum Lichtenberg und vom Bezirksamt Lichtenberg, Dr. Dirk Moldt. Parallel wurde ich auf einige weitere relevante Veranstaltungen aufmerksam.
Die lokale Anton-Saefkow-Bibliothek gab leider eine schnelle Absage hinsichtlich des Vorhandenseins dort archivierter Materialien wie Festschriften, Chroniken, Fotos oder Zeitungsartikel. Die dortige Suche nach Literatur über den Ort und seine Geschichte zeigte sich hingegen als überraschend ergiebig. Neben einigen Büchern, die sich vor allem der generellen Historie Lichtenbergs widmen, hat die neuerliche Faszination für die Neubauten und Architektur der DDR zu einigen sehr aktuellen Veröffentlichungen geführt – darunter das Werk des Stadtplaners Georg Balzer Das Berliner Wohngebiet Fennpfuhl. Das Buch gibt nicht nur einen detaillierten Einblick in die Historie und Entwicklung des Ortes, sondern brachte mir auch das erste Foto des Schulgebäudes (siehe Abb. 17 auf der Hauptseite). Während der Grundlagenrecherche über die Historie des Fennpfuhls in den ausgeliehenen Büchern stellte sich schnell heraus, dass der größte Teil aller in der Literatur verwendeten historischen Fotos im Archiv vom Museum Lichtenberg lag, zu dem ich bereits Kontakt hatte.
Am 17. Mai besuchte ich eine jährlich stattfindende Führung durch das Neubaugebiet, auf die ich beim Besuch des Museums aufmerksam wurde. Die Führung stellte sich aber auch in weiterer Hinsicht als großer Glücksfall heraus. Sie brachte nicht nur umfassende Einblicke in die Besonderheiten und die Einzigartigkeit des Ortes. Unerwartet schloss sich der Führung auch der ehemalige Komplexarchitekt Dieter Rühle an. Dieser konnte nicht nur aus erster Hand über die Ereignisse der 70er und 80er Jahre berichten, sondern gab durch seine während seiner Pensionierung anhaltende beratende Tätigkeit Einblicke hinter die Kulissen zeitaktueller Entscheidungen.
Als mir Dr. Dirk Moldt Ende Mai Fotos aus dem Alltag der Schule an der Rudolf-Seiffert-Straße 37 schickte, eröffnete sich mir eine entscheidende Wissenslücke, die meine Recherche bis dahin unbewusst erschwert hatte. Die auf den Fotos abgebildeten Schüler*innen wirkten selbst für eine höhere Grundschulklasse deutlich zu alt. Zudem waren die Fotos mit der mir bis dahin unbekannten Abkürzung „POS“ gekennzeichnet. Wegen des Verweises auf „Oberschule“ vermutete ich kurz, dass die Archivleitung die 4. Grundschule Berlin-Lichtenberg mit dem Gottfried-Herder-Gymnasium verwechselt haben könnte. Der Irrtum lag jedoch bei mir.
Erst die Beschäftigung mit dem Schulsystem der DDR brachte neue Erkenntnisse, Einblicke und Anknüpfungspunkte für die weitere Beschäftigung mit meiner ehemaligen Schule.
Um ein anderes Projekt rechtzeitig abschließen zu können, ergab sich im Juni eine längere Pause. Nach einer Besprechung mit der Betreuung konzentrierte sich die weitere Recherche ab Anfang Juli auf die Suche nach historischem Kartenmaterial, um die langfristige städtebauliche Entwicklung des Ortes anschaulicher darstellen zu können. Dabei entstanden wertvolle Kontakte zur Plattform berliner-stadtplansammlung.de des privaten Sammlers Michael Müller und zur vom Landesarchiv Berlin betriebenen Seite histomapberlin.de.
Parallel dazu beschäftigte ich mich im Juli mit Aspekten, die über die rein städtebauliche Planung und Entwicklung hinausgehen. Mit Blick auf den Standort an der Rudolf-Seiffert-Straße erschien beispielsweise die Benennung vieler Straßennamen nach Personen aus dem Widerstand gegen das NS-Regime besonders relevant. Mit dem Beschluss, den Fokus auf die Ortsentwicklung zu legen, traf ich zu diesem Zeitpunkt auch Entscheidungen darüber, welche Perspektiven zunächst außen vorgelassen werden sollten und bei einer späteren Revision der Seite ergänzt werden könnten. So verwarf ich nach einigen Hürden zunächst das Ziel, weiter nach ganz konkreten Persönlichkeiten der Schule oder Meilensteinen zur Schulhistorie zu suchen. Dabei behielt ich mir jedoch vor, diese Recherchen zu einem späteren Zeitpunkt erneut aufzugreifen.
Ende Juli, Anfang August startete eine recht intensive Phase, in der die gesammelten Informationen und Fotos auf der Website kuratiert und zusammengetragen wurden. Nachdem die grundsätzliche Recherche zu dem Zeitpunkt abgeschlossen war, bestanden die Herausforderungen nun in der Formulierung von für eine Website geeigneten Texten, der Umgang mit der Plattform Webador für die Erstellung der Website sowie die Berücksichtigung rechtlicher Bedingungen. Seit dem 20.08.2025 ist die Seite öffentlich erreichbar. Nach einer Korrekturphase wurde die Arbeit an der Website am 01.09.2025 bis zur Bewertung vorläufig ausgesetzt.
Reflexion
Durch meine Arbeit als Mediengestalter konnte ich bereits im Vorfeld Erfahrungen in verschiedenen Rollen bei der Arbeit an Websites sammeln. Bei diesem Projekt handelte es sich jedoch um die erste Website, die ich, von der Konzeption über die Recherche und Aufbereitung der Inhalte bis hin zur Auswahl der Plattform, vollständig selbst entwickelt habe. Dieser ganzheitliche Ansatz stellte eine wertvolle Lernerfahrung dar, da sowohl kreative als auch methodische und organisatorische Entscheidungen getroffen werden mussten und sich deren Wechselwirkung unmittelbar nachvollziehen ließ.
Inhaltlich erwies sich die Auseinandersetzung mit meiner ehemaligen Schule als überraschend vielschichtig. Die anfängliche Erwartungshaltung, in einem begrenzten Rahmen über das Gebäude berichten zu können, wich schnell der Einsicht, dass dessen Geschichte nicht von der städtebaulichen Planung des DDR-Neubaugebietes zu lösen ist. Daraus ergab sich die Herausforderung, das Thema thematisch zu fokussieren.
Gleichzeitig erwies sich die Schule als ein dankbares Untersuchungsobjekt: Ihre Geschichte ist mit dem Bau um 1976 und dem Abriss um 2005 in sich abgeschlossen und auch durch den Kontext des Neubaugebietes verhältnismäßig klar umrissen. Diese zeitliche Begrenzung erleichterte die Strukturierung der Darstellung, da keine offenen Entwicklungen mehr zu erwarten sind. Auf Grundlage der bisherigen Recherche besteht nun die Möglichkeit, die Darstellung künftig schrittweise um eine endliche Zahl weiterer Details zur Schule zu ergänzen.
Rückblickend erwies sich für den Rechercheprozess als problematisch, dass ich auf einige zentrale Informationen und Quellen erst sehr spät stieß. Beispielsweise beschäftigte ich mich über einen längeren Zeitraum intensiv mit der Auswahl verschiedenster Kartenmaterialien aus unterschiedlichen Beständen. Die Sammlung frei verfügbarer Luftbilder von ganz Berlin fiel mir jedoch erst zu einem sehr späten Zeitpunkt in der Recherche auf. Zwar konnte ich diese letztlich noch in das Projekt integrieren, die späte Entdeckung verweist jedoch auf eine gewisse Lücke in meiner Herangehensweise an die Recherche. Möglicherweise hat sich hier insbesondere bei der Internetrecherche der bereits angesprochene Überfluss an Daten beziehungsweise die Vielzahl der „Präsenzen“ und der unterschiedlichen Formen, die sie einnehmen können, bemerkbar gemacht. Für künftige Projekte erscheint es demnach sinnvoll, Methoden für einen früheren und systematischeren Überblick über potenzielle Quellen und Materialien zu entwickeln.
Hinsichtlich der Suche, Filterung und Zusammenstellung der Informationen soll nicht unerwähnt bleiben, dass ich als Autor die zentrale Instanz war, die darüber entschied, welche Aspekte der Schulgeschichte und des Ortes Fennpfuhl sichtbar gemacht werden. Bei der Auswahl der Inhalte wurde dadurch noch einmal deutlich, dass Erinnerungsarbeit immer auch von individuellen Entscheidungen und subjektiven Prioritäten geprägt ist. Ebenfalls muss berücksichtigt werden, dass die Website selbst eine weitere Präsenz im Internet darstellt, die jedoch die Absicht verfolgt, neu zusammengetragene Inhalte mit bereits vorhandenen zu verknüpfen und dadurch Mehrwert zu erzeugen.
Eine weitere Herausforderung stellte die Wahl der Plattform für die Erstellung und das Hosting der Website dar. Ein zentrales Ziel des Projekts war es, die Ergebnisse nicht nur in Form eines Entwurfs, sondern auch tatsächlich online zugänglich zu machen. Nach einigen Tests und technischen Schwierigkeiten mit zuvor genutzten Werkzeugen, darunter WordPress, entschied ich mich schließlich für Webador. Der vergleichsweise begrenzte Funktionsumfang erwies sich hier als Vorteil, da er eine einfache Handhabung und damit die Konzentration auf die wesentlichen Projektziele ermöglichte. Notwendige Zusatzfunktionen wie die Bereitstellung einer eigenen Domain waren jedoch mit privaten Kosten verbunden. Aus diesem Grund ist die Website zeitlich begrenzt und wird voraussichtlich Ende Juli 2026 wieder abgeschaltet.
Beim Aufbau der Website und der Strukturierung der Informationen habe ich mich für einen zusammenhängenden chronologischen Text entschieden, der sich dem Thema zudem in einer Art Lupenperspektive nähert. Der Einstieg in die historische Entwicklung des Wohngebietes eröffnet einen weiten Blick auf die Rahmenbedingungen seiner Entstehung und darauf, wie diese das Erscheinungsbild wie auch das Leben im Ortsteil prägten. Sobald der Fokus jedoch auf das Schulgebäude selbst gelenkt wird, verengt sich die Perspektive auf den Rudolf-Seiffert-Park. Zwar ließe sich zur Entwicklung des Ortsteils und seiner baulichen Veränderungen noch einiges berichten, nach dem Abriss des Gebäudes erscheinen diese Aspekte für die Untersuchung des eigentlichen Objekts jedoch nur noch von nachrangiger Bedeutung. Eine Inspiration bot dabei unter anderem die Website https://immermodern.de/strassen-von-heute/leninallee, welche die Informationen ebenfalls in kurzen Texten und dazugehörigen Bildern chronologisch anordnet und durch ihre Gestaltung als eigenständige Seite bestehen kann. Im Kontrast zu einer vernetzten Struktur zielt der Aufbau als „Semi-Onepager“ darauf ab, die Idee zu unterstreichen, dass die einzelnen Aspekte nur schwer getrennt voneinander betrachtet werden können.
Das baukastenartige System von Webador hat einen sehr modularen Aufbau der Dokumentation ermöglicht. Gemeinsam mit der chronologischen Erzählweise bietet sich so die Möglichkeit, jederzeit neue Module zu ergänzen und weitere Informationen hinzuzufügen, ohne komplexe Umstrukturierungen vornehmen zu müssen. Die dadurch entstehenden Möglichkeiten unterstützen das Vorhaben, auf dem vorhandenen Grundgerüst aufzubauen und die Website bis zum Ende der Laufzeit weiter zu erweitern.
Aus dem Umfang und der damit einhergehenden Länge der Seite ergeben sich jedoch einige Schwierigkeiten bei der Navigation. Webador ermöglicht eine Menüleiste, die am oberen Bildschirmrand fixiert ist. Das erlaubt es, jederzeit die Seite zu wechseln, ohne weitläufig scrollen zu müssen. Jedoch scheint es keine Sprungmarken zu geben, die das Springen an bestimmte Punkte innerhalb der Seite erlauben. Es war dadurch nicht möglich, ein Inhaltsverzeichnis anzulegen, das der Navigation deutlich zuträglich gewesen wäre. Die Struktur und Übersichtlichkeit der Dokumentation gerät damit bereits jetzt an Grenzen. Bei einer zukünftigen Erweiterung der Seite müsste das berücksichtigt werden.
Die Umsetzung als öffentlich zugängliche Website hat es ermöglicht, vielfältige Querverweise auf verwendete Quellen und verwandte Projekte einzubinden und das Ergebnis stärker mit anderen Arbeiten zu vernetzen. Der Austausch mit den für die verschiedenen Quellen zuständigen Personen erwies sich dabei als besonders erfreulich und hilfreich. An dieser Stelle sei herzlich gedankt: Andreas Matschenz vom Landesarchiv Berlin, Dr. Dirk Moldt vom Museum Lichtenberg sowie Michael Müller von der Berliner Stadtplansammlung, die zahlreiche Bildquellen und Materialien unkompliziert bereitgestellt haben.
Auf der dokumentarischen Website wurden die gesammelten Fotos und Daten aus den Archiven aufbereitet und mit Informationen aus der Literatur zu einer Erzählung rund um die ehemalige Schule verdichtet. Wie die bereits betrachteten Überlegungen Erls zum kulturellen Gedächtnis nahelegen, fungiert die Website damit als Zirkulationsmedium: Sie eröffnet neue Wege der Vernetzung, senkt Hürden der Zugänglichkeit und bietet dadurch andere Möglichkeiten, Inhalte sichtbar zu machen. Gleichwohl bleibt eine Leerstelle bestehen. Ohne die physische Präsenz des Gebäudes – sei es in Form einer Fassade, eines Denkmals oder auch nur eines markanten Orts im Stadtraum – fehlen weiterhin jene materiellen Anknüpfungspunkte, die Erinnerungsprozesse im Alltag anregen.
Fazit und Ausblick
Das Suchen und Zusammenführen fragmentierter Informationen, die Beschäftigung mit der Geschichte des Ortes Fennpfuhl und der Aufbau einer Erzählung haben auf sehr praktische Weise erste Einblicke in das Themenfeld der Erinnerungskultur ermöglicht. Zentrale Projektziele – etwa die Aktivierung von „totem“ oder nur schwer zugänglichem Wissen durch die Bereitstellung auf einer Website – konnten erreicht werden. Die Dokumentation trägt dazu bei, das Schulgebäude wieder erinnerbar zu machen. Dabei zeigte sich, welche Rolle Medien im kulturellen Gedächtnis durch Speichern, Verbreiten und Auslösen von Erinnerungen einnehmen können. Ergänzend konnte die Bedeutung des Vergessens und der Einfluss eines Überflusses an Erinnerungen angesprochen werden.
Als mediales Angebot und Zirkulationsmedium bietet die Web-Dokumentation einen ersten Anknüpfungspunkt, der in Zukunft weiter ausgebaut werden kann. Sie eröffnet die Möglichkeit, zusätzliche Informationen einzubinden und in das bestehende Gerüst einzufügen. Eine vergleichsweise einfache Weiterentwicklung könnte darin bestehen, die Website durch einen Social-Media-Auftritt zu ergänzen, um gezielt nach weiteren Erinnerungen und Materialien von Zeitzeug*innen zu suchen. Auf diese Weise ließen sich die bislang persönlichen Anekdoten unkompliziert durch weitere Perspektiven und Erfahrungen aus verschiedenen Jahrgängen erweitern.
Die Kontaktaufnahme mit Bezirks- und Schulämtern wurde nach einem zunächst erfolglosen Versuch und einer veränderten Schwerpunktsetzung innerhalb der Projektarbeit nicht weiterverfolgt. Auch wenn die Erfolgsaussichten, etwa aufgrund von Persönlichkeitsrechten, derzeit begrenzt erscheinen, könnten detailliertere Einblicke in amtliche Akten und Dokumente zur Schule eine wertvolle Ergänzung darstellen. Aufgrund der anfallenden Kosten ist vorgesehen, die Dokumentation im Juli 2026 wieder aus dem Netz zu nehmen. Sollte das Projekt über diesen Zeitpunkt hinaus fortgeführt werden können, wären erneute Kontaktaufnahmen mit den zuständigen Ämtern durchaus denkbar.
Wie bereits festgestellt, kann die Website allein nur einige der notwendigen Aspekte eines wirksamen Erinnerungsmediums erfüllen. Da mediale cues im Stadtbild weiterhin fehlen, ist es realistisch einzuschätzen, dass die Dokumentation abseits der eigenen praktischen Forschung und Übung nur begrenzten Mehrwert bietet. Nach vorheriger Absprache mit zuständigen Stellen wären künftig Hinweise auf die Website durch QR-Codes in der näheren Umgebung denkbar.
Abschließend lässt sich festhalten, dass die Arbeit nicht nur zur Erinnerung an ein einzelnes Schulgebäude beiträgt, sondern exemplarisch aufzeigt, wie Erinnerungsprozesse sichtbar gemacht werden können. Auch Fragen zum Umgang mit Architektur, insbesondere von Gebäuden mit einer, vom Zeitgeist abhängigen, geringeren kulturellen Relevanz, werden deutlich. Für mich persönlich bot das Projekt wertvolle Erfahrungen in der Archivrecherche, digitalen Aufbereitung und im Umgang mit der Konstruktion und Vermittlung von Erinnerung. Gleichzeitig liefert es für weitere Projekte einen ersten Einstieg und Anregungen für den Umgang mit anderen verschwundenen Orten und die Rolle verschiedener Medien im kulturellen Gedächtnis.
Quellenverzeichnis
- Balzer, G., Ryssel, K., & Reichelt, C. (2007). Integriertes Stadtteilentwicklungskonzept 2007 – Fennpfuhl. Bezirksamt Lichtenberg von Berlin, Amt für Planen und Vermessen, Fachbereich Stadtplanung.
-
Carow, H. (Regisseur). (1979). Bis daß der Tod euch scheidet [Film]. DEFA.
- Erl, A. (2005). Kollektives Gedächtnis und Erinnerungskulturen – Eine Einführung. J.B.Metzler.
- Esposito, E. (2002). Soziales Vergessen – Formen und Medien des Gedächtnisses der Gesellschaft.
Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft. - Groys, B. (1997). Logik der Sammlung – Am Ende des musealen Zeitalters (M. Krüger, Hrsg.). Carl Hanser Verlag.
- Welzbacher, C. (2010). Durchs wilde Rekonstruktistan. Über gebaute Geschichtsbilder. Parthas Verlag Berlin.
-
Zschoche, H. (Regisseur). (1965). Karla [Film]. DEFA.